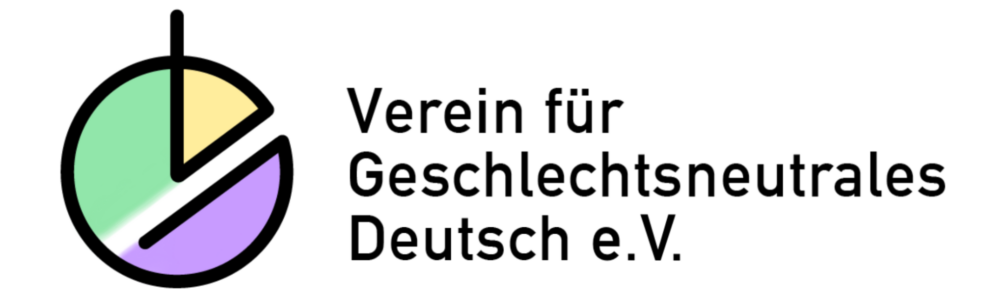Hinweis: Die meisten Vorschläge auf dieser Seite wurden bisher noch nicht in unseren Online-Foren diskutiert und zur Abstimmung gestellt, sondern nur von den beiden Vereinsvorsitzenden Marcos Cramer und Averyn Hiell ausgearbeitet.
Auf dieser Seite erläutern wir ergänzend zu der Beschreibung des De‑e‑Systems, wie geschlechtsneutrale Alternativen zu Substantiven lauten könnten, deren weibliche Form einen anderen Wortstamm verwendet als die männliche. Außerdem schlagen wir Alternativen für die Pronomen man und jemand vor.
Substantive
Es gibt einige Personensubstantive, bei denen der Wortstamm eine Aussage über das Geschlecht der Person trifft, nicht nur die Endung und das Genus.
Allgemein
Person
Anstatt Mann und Frau kann meistens Person verwendet werden. Wenn betont werden soll, dass es sich um eine erwachsene Person handelt, kann auch de Erwachsene gesagt werden. Die Verwendung von Person (und im Plural Leute) bietet sich auch bei zusammengesetzten Wörtern an:
- Ehemann/Ehefrau: Eheperson, Eheleute (auch: Ehepartnere, Partnere)
- Feuerwehrmann/Feuerwehrfrau: Feuerwehrperson, Feuerwehrleute
- Putzmann/Putzfrau: Putzperson, Putzleute
- Kaufmann/Kauffrau: Kaufperson, Kaufleute
- Bergmann/Bergfrau: Bergperson, Bergleute
Es gibt die von Kaufmann und Bergmann abgeleiteten Adjektive kaufmännisch und bergmännisch. Hierzu empfehlen wir die Alternativen kaufleutisch und bergleutisch.
Für die geschlechtsneutrale formale Anrede bietet es sich an, statt Herr oder Frau das Wort Person zu verwenden, z. B. Person Müller statt Frau Müller oder Herr Müller. Mehr Infos zu Anredeformen gibt es hier.
-menschchen
Es gibt einige Wörter, die auf ‑männchen enden, ohne dass sie notwendigerweise auf männliche Wesen verweisen. Die geläufigsten davon sind wohl Ampelmännchen, Strichmännchen und Stehaufmännchen. Das Element ‑männchen verweist dabei immer auf die eine oder andere Weise auf eine Ähnlichkeit mit dem menschlichen Körper. Daher schlagen wir vor, statt ‑männchen das Wort ‑menschchen anzuhängen. Da es sehr ähnlich klingt und aussieht, wären die resultierenden Zusammensetzungen wohl für die meisten auf Anhieb verständlich. Auch in der Phrase Männchen machen könnte stattdessen Menschchen verwendet werden, da es dabei ja nur um die Ähnlichkeit mit dem Stand und Gang eines Menschen geht. Wohl aus einem ähnlichen Grund enthält auch das Wort Erdmännchen einen Hinweis auf den Mann. Neben Erdmenschchen wäre auch Surikate als Ersatz denkbar, ein weniger gebräuchlicher Name des Tiers, der aber auch in anderen Sprachen benutzt wird.
Enby
Wenn es explizit um nichtbinäre Menschen geht, kann einfach von „nichtbinären Personen/Menschen“ gesprochen werden. Manche wünschen sich aber auch analog zu den Wörtern Frau und Mann eine Möglichkeit, das Konzept ‚nichtbinäre Person‘ in nur einem Wort zum Ausdruck zu bringen. Dafür bietet sich das Wort Enby an, das sich auf Grundlage der Aussprache der Abkürzung NB für non-binary zuerst in der englischsprachigen nichtbinären Community und danach auch in der deutschsprachigen verbreitet hat. Die Pluralform lautet Enbys oder Enbies (die Form Enbys entspricht der deutschen Rechtschreibnorm, aber manche Personen verwenden trotzdem auf Deutsch die englische Schreibweise Enbies). Das y wird nicht wie im Deutschen Psyche als ü-Laut ausgesprochen, sondern wie das y in Hobby als i-Laut: [ˈɛnbi]. Es sollte beachtet werden, dass einige nichtbinäre Personen das Wort Enby nicht mögen und es daher beim Sprechen über eine konkrete Person nur verwendet werden sollte, wenn de Sprechere weiß, dass diese sich mit dem Wort wohlfühlt.
Sonstige
Bei Hundehalternen empfiehlt es sich, statt Frauchen und Herrchen die geschlechtsneutrale Form Haltere oder Halterchen zu verwenden.
Das Wort Jungfrau wird im Deutschen geschlechtsneutral verwendet, doch es ist nicht nur wegen der Geschlechts-Spezifizität des zweiten Wortbestandteils ‑frau problematisch, sondern auch in der Herkunft, da früher der Jungfernschaft von Frauen gesellschaftlich mehr Bedeutung beigemessen wurde als der von Männern. Wir schlagen vor, den etwas veralteten Begriff Jungfer als Basis für eine inklusivische Wortform zu verwenden, in dem weniger stark das Wort Frau und damit die historische sexistische Bedeutung anklingt, auch wenn sich der Wortbestandteil ‑fer aus einer älteren Wortform von Frau entwickelt hat. Wie die größte Gruppe von Personenwörtern endet auch Jungfer auf ‑er (vgl. Schüler etc.), auch wenn das natürlich nur Zufall ist. Die Form de Jungfere passt dadurch aber gut zu Wörtern wie de Schülere. Der Plural lautet entsprechend Jungferne. Das Adjektiv jungfräulich empfehlen wir durch die Form jungferlich zu ersetzen.
Das Wort Android(e) wird oft geschlechtsneutral für einen menschenähnlichen Roboter jeglichen Geschlechts benutzt. Allerdings kommt es vom altgriechischen Wort andrós, das ‚Mann‘ bedeutet (manchmal zwar auch ‚Mensch‘, aber dann handelt es sich um eine Art des generischen Maskulinums, vergleichbar mit man im Englischen). Es gibt auch ein weniger gebräuchliches weibliches Gegenstück: Gynoid(e), von altgriechisch gynḗ ‚Frau‘. Wir schlagen daher die Alternative Anthropoid(e) vor, die vom Wort ánthrōpos für ‚Mensch‘ abgeleitet ist, was im Gegensatz zu andrós nicht spezifisch für Männer benutzt wurde. Da sowohl Android(e) als auch Gynoid(e) maskulin sind, halten wir es für unproblematisch, der Anthropoid zu sagen, im Plural die Anthropoiden. Es gibt noch das Wort Droid(e), welches von Androide abgeleitet ist. Allerdings ist es so weit davon entfernt, dass wir nicht glauben, dass viele Menschen es mit dem altgriechischen Wort für ‚Mann‘ assoziieren werden.
Es gibt im Deutschen die geschlechtsneutralen Begriffe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die für die jeweiligen Altersgruppen statt Mädchen oder Junge verwendet werden. Doch es gibt keinen Begriff, der diese drei Gruppen zusammenfasst und Junge oder Mädchen in jedem Kontext ersetzen kann. Viele Leute benutzen im Plural den Anglizismus Kids mehr oder weniger in derselben Bedeutung wie Jungen und Mädchen, sodass sich dies gut anbietet. Im Singular könnte einfach de Kid gesagt werden.
Verwandtschaft
Verwandtschaftsbezeichnungen bilden die größte Gruppe der Personen-Substantive, deren weibliche und männliche Form unterschiedliche Wortstämme haben.
Geschwister und Kinder
Die wohl meistverwendete geschlechtsneutrale Verwandtschaftsbezeichnung ist Geschwister für Schwester/Bruder. Bisher wird das Wort vor allem im Plural verwendet, aber es gibt auch die Singularform das Geschwister, die vor allem in der Fachsprache Anwendung findet, seit einigen Jahren aber auch vermehrt in der Umgangssprache. Hier ist es naheliegend, das grammatische Geschlecht anzupassen: de Geschwister. Der Plural würde noch immer die Geschwister lauten.
Statt Sohn/Tochter wird natürlich meist Kind verwendet. Einige Jugendliche oder Erwachsene empfinden das allerdings als unpassend, weshalb wir das etwas veraltete Wort Spross vorschlagen, wobei es bei der Wiederbelebung dieses Wortes naheliegt, es jetzt im Inklusivum zu verwenden: de Spross. Bisher hat das Wort Spross zwei Pluralformen: Sprosse und Sprossen. Da Letzteres aber auch der Plural von Sprosse ist, schlagen wir vor, nur die erste Form zu verwenden: die Sprosse.
Eltern und Großeltern
Auch für Mutter/Vater gibt es bereits einen existierenden geschlechtsneutralen Begriff: Elter. Er wird zwar meist im Plural verwendet – vor allem in der Fachsprache aber auch im Singular. Bisher ist es ein Neutrum, doch wir schlagen vor, genau wie bei Geschwister das grammatische Geschlecht zum Inklusivum zu ändern: de Elter. Auch hier würde sich der Plural nicht ändern (die Eltern). Analog dazu ist Großelter die geschlechtsneutrale Alternative zu Großmutter und Großvater. Des Weiteren kann das Wort Elter auch verwendet werden, um Muttersprache zu entgendern: Eltersprache.
Als geschlechtsneutrale Alternative zu Mama/Mami und Papa/Papi schlagen wir Tata/Tati, Baba/Babi oder Fafa/Fafi vor. Ähnlich kann mensch Ota/Oti, Oba/Obi oder Ofa/Ofi als geschlechtsneutrale Alternativen zu Oma/Omi und Opa/Opi verwenden. Statt Mutti und Vati bietet sich Elti an. Anders als die anderen hier vorgestellten Wörter sind die in diesem Absatz angesprochenen Koseformen von sehr persönlicher Natur. Die Vorschläge richten sich lediglich an Eltern und Großeltern, die nach einem geschlechtsneutralen Kosenamen suchen, bei dem ihre (Enkel)kinder sie rufen können. Es sollte davon abgesehen werden, eine solche Koseform generisch für ein (Groß)elter zu verwenden, de möglicherweise oder sogar wahrscheinlich eine andere Form präferiert.
Sonstige
Für einige Verwandtschaftsbezeichnungen bietet es sich an, eine geschlechtsneutrale Form durch Verschmelzung der existierenden Formen bilden:
- Neffe/Nichte: de Nefte, die Neften
- Tante/Onkel: de Tonke, die Tonken
- Cousine/Cousin: de Couse, die Couserne (mit Betonung auf der ersten Silbe)
Diese Begriffe sind nicht nur praktisch, um über einzelne nichtbinäre Personen zu sprechen, sondern auch, um z. B. „Gesamtheit der Geschwister der Eltern“ in einem Wort zusammenzufassen, anstatt umständlich „Tanten und Onkel“ sagen zu müssen.
Zusammenfassung
Hier ist eine Liste mit allen oben vorgestellten Vorschlägen:
- Mann/Frau: Person (oder: de Erwachsene)
- Ehemann/Ehefrau: Eheperson, Eheleute (oder: Ehepartnere, Partnere)
- Feuerwehrmann/Feuerwehrfrau: Feuerwehrperson, Feuerwehrleute
- Putzmann/Putzfrau: Putzperson, Putzleute
- Frau/Herr: Person
- nichtbinäre Person: Enby, Enbys (oder: Enbies)
- Frauchen/Herrchen: Haltere, Halterne (oder: Halterchen)
- Jungfrau: Jungfere, Jungferne
- jungfräulich: jungferlich
- Android(e)/Gynoid(e): der Anthropoid(e), Anthropoiden
- Junge/Mädchen: Kid, Kids
- Bruder/Schwester: Geschwister, Geschwister
- Tochter/Sohn: Spross, Sprosse
- Mutter/Vater: Elter, Eltern
- Muttersprache: Eltersprache
- Mutti/Vati: Elti, Eltis
- Mama/Papa: Tata, Tatas (oder: Baba, Babas; Fafa, Fafas)
- Mami/Papi: Tati, Tatis (oder: Babi, Babis; Fafi, Fafis)
- Oma/Opa: Ota, Otas (oder: Oba, Obas; Ofa, Ofas)
- Omi/Opi: Oti, Otis (oder: Obi, Obis; Ofi, Ofis)
- Neffe/Nichte: Nefte, Neften
- Tante/Onkel: Tonke, Tonken
- Cousine/Cousin: Couse, Couserne (mit Betonung auf der ersten Silbe)
Lediglich Person und die Formen, die auf ‑person enden, sind nicht grammatisch inklusivisch. Für alle anderen Vorschläge bietet es sich an, den Artikel de zu verwenden.
Pronomen
Man
Neuschöpfungen
Obwohl das Indefinit-Pronomen man semantisch immer geschlechtsneutral war, führt seine Ähnlichkeit zum Wort Mann bei manchen zu Unbehagen. Wir empfehlen daher als Alternative zu man das Wort mensch, das schon seit mehreren Jahren Verwendung findet. Alternativ dazu ist auch die durch süddeutsche dialektale Formen motivierte Form ma denkbar: Sie hat den Vorteil, klanglich nah genug an man zu sein, um relativ leicht als Variation davon angesehen zu werden, und vermeidet gleichzeitig, dass das Pronomen genauso wie das Substantiv Mann klingt. Andererseits hat ma den Nachteil, klanglich kaum von man unterscheidbar zu sein und außerdem leicht als Rechtschreibfehler interpretiert werden zu können.
Im Dativ und Akkusativ wird man im traditionellen Sprachgebrauch durch das Pronomen einem bzw. einen ersetzt. Diese Formen sollten dann natürlich ebenfalls ins Inklusivum übertragen werden: einerm im Dativ und einey im Akkusativ.
Außerdem wird auf man bisher mit maskulinen Possessivformen verwiesen: „Man sollte vor dem Essen seine Hände waschen.“ Dies ist auch eine Form des generischen Maskulinums. Statt des maskulinen sein schlagen wir vor, die Possessivform ens des inklusivischen Personalpronomens en zu verwenden: „Mensch sollte vor dem Essen ense Hände waschen.“
Etablierte Alternativen
Es gibt noch ein paar Ausweichlösungen, die zwar nicht in jedem Kontext funktionieren, aber dafür bereits in der Standardsprache existieren:
- Formulierung mit Passiv
- funktioniert: „Man darf hier nicht rennen.“ → „Hier darf nicht gerannt werden.“
- funktioniert nicht: „Das weiß man doch.“ → *„Das wird doch gewusst.“
- Formulierung mit sich
- funktioniert: „Wie spricht man dieses Wort aus?“ → „Wie spricht sich dieses Wort aus?“
- funktioniert nicht: „Das sollte man nicht sagen.“ → *„Das sollte sich nicht sagen.“
- Formulierung mit sich lassen
- funktioniert: „Das kann man herausfinden.“ → „ Das lässt sich herausfinden.“
- funktioniert nicht: „Man tut, was man kann.“ → *„Es lässt sich tun, was sich tun lässt.“
- Formulierung mit ich
- funktioniert: „Bei dem Lärm versteht man sich selbst nicht mehr.“ → „Bei dem Lärm verstehe ich mich selbst nicht mehr.“
- funktioniert nicht: „Man kann sagen, was man will, aber das war beeindruckend.“ → *„Ich kann sagen, was ich will, aber das war beeindruckend.“
- Formulierung mit wir
- funktioniert: „Man sieht noch deinen Schopf.“ → „Wir sehen noch deinen Schopf.“
- funktioniert nicht: „Man hat sehr positiv auf mein Outing reagiert.“ → *„Wir haben sehr positiv auf mein Outing reagiert.“
- Formulierung mit du
- funktioniert: „Wenn man lauscht, kann man die Gänse hören.“ → „Wenn du lauschst, kannst du die Gänse hören.“
- funktioniert nicht: „Man hat mir gesagt, du wärst krank.“ → *„Du hast mir gesagt, du wärst krank.“
(Einige der Umformulierungen, die mit „funktioniert nicht“ und einem Asterisk (*) markiert sind, ergeben durchaus Sinn, sind aber nicht gleichbedeutend mit der Formulierung mit „man“.)
In den meisten Kontexten lässt sich das Wort man umgehen durch eine der oben vorgestellten Alternativen oder eine gänzlich andere Umformulierung (z. B. „Ein anständiger Mensch macht sowas nicht.“ statt „Das macht man nicht.“). Da mensch dafür aber praktisch in jedem Fall all diese Alternativen durchgehen müsste, ist es praktischer, stattdessen das Wort mensch zu verwenden, das in jedem Kontext man ersetzen kann.
Jemand und niemand
Neuschöpfungen
Genau wie man ist auch jemand bzw. niemand in seiner Bedeutung bereits geschlechtsneutral, doch auch hier fühlen sich einige Menschen an das Wort Mann erinnert. Eine Lösung, die in ihrer Form gut zu mensch passt, wäre jemensch bzw. niemensch. Doch da die Grundform jemand/niemand klanglich deutlich weiter von Mann entfernt ist als man, sehen wir eine Ersetzung des Wortes als weniger naheliegend an.
Es gibt allerdings noch zwei weitere Probleme mit jemand bzw. niemand:
Erstens wird es bisher maskulin dekliniert: jemand/jemandes/jemandem/jemanden. Im Inklusivum bietet es sich an, entweder keine Deklination vorzunehmen (wie es bereits häufig gemacht wird, z. B. „Ich habe jemand die Tür aufgehalten.“ statt „Ich habe jemandem die Tür aufgehalten.“) oder analog zum unbestimmten Artikel zu deklinieren: jemand/jemanders/jemanderm/jemand. Die endungslose Variante funktioniert nur im Dativ und Akkusativ, im Genitiv sollte in jedem Fall „jemanders“ verwendet werden, wenn eine männliche Assoziation vermieden werden soll.
Zweitens wird auf jemand und niemand wie auf man bisher mit maskulinen Wörtern verwiesen: „Jemand, der auf dem Bahnhof war, hat seine Tasche hier vergessen. Hoffentlich bekommt er sie zurück.“ Auch dies ist eine Form des generischen Maskulinums und kann ebenfalls recht einfach mit den Formen des Inklusivums gelöst werden: „Jemand, de auf dem Bahnhof war, hat ense Tasche hier vergessen. Hoffentlich bekommt en sie zurück.“
Etablierte Alternativen
Wenn eine Ausweichlösung für jemand gewünscht ist, die mit den etablierten Regeln der deutschen Sprache konform ist, empfehlen wir eine Person. Der Ausdruck ist zwar doppelt so lang wie das Wort jemand, kann dieses aber praktisch immer ersetzen und ist eindeutig geschlechtsneutral. Außerdem gibt es zwei Alternativen, die in der Umgangssprache bereits sehr verbreitet sind, allerdings nicht in jedem Kontext funktionieren:
- Formulierung mit wer
- funktioniert: „Es hat jemand das Licht angelassen.“ → „Es hat wer das Licht angelassen.“
- funktioniert nicht: „An der Tür ist jemand Fremdes.“ → *„An der Tür ist wer Fremdes.“
- Formulierung mit irgendwer
- funktioniert: „Da ist jemand.“ → „Da ist irgendwer.“
- funktioniert nicht: „Ich kenne jemanden, der Chinesisch spricht.“ → *„Ich kenne irgendwen, de Chinesisch spricht.“
Allerdings nehmen wer und irgendwer bisher auch maskuline Bezugswörter an, sodass durch sie nur die klangliche Nähe zu Mann vermieden werden kann.